
Objekt des Monats
Wien wuchs mit Steinen aus dem Leithagebirge. Ob Stephansdom, die beiden Museen am Maria-Theresien-Platz, die Neue Hofburg oder Ringstraßenbauten –
die Leithakalke waren stets an vorderster Stelle repräsentativer Architekturvorhaben dabei. Eigentlich ist das nicht verwunderlich, da es eine
lange Tradition ihrer Gewinnung und Verwendung gibt. Die nur wenige Kilometer vom Leithagebirge entfernte römische Ausgrabungsstätte
Carnuntum an der Donau bei Bad Deutsch-Altenburg sowie der „Römersteinbruch“ bei St. Margarethen zwischen Eisenstadt (ungar. Kismarton)
und dem Neusiedler See verweisen auf eine intensive frühe Steingewinnung in dieser Region.
An einem der wichtigsten Abbauorte des Westabhangs dieses Gebirgszuges nahe dem Neusiedler See wurde diese Tradition in bemerkenswerter Weise dokumentiert.
Das Stadtmuseum Mannersdorf ist im ehemals herrschaftlichen „Schüttkasten“ (Abb. 1) – einem 1579 errichteten herrschaftlichen Wirtschaftsgebäude in der Stadt –
untergebracht.

Abb. 1: Das Museum in Mannersdorf (gesehen von der Straßenseite)
Es bewahrt und zeigt Objekte aus vier thematischen Bereichen: Archäologie, Minerale und Fossilien des Leithagebirges, Volkskunde und Stadtgeschichte, ...
sowie Steinmetztechnik. Im langen und geräumigen Gewölbekeller des Gebäudes erstreckt sich eine Ausstellung über den Steinabbau bei Mannersdorf und die
weitere Verarbeitung. Es ist nicht übertrieben, wenn die ausgestellten Kollektionen von römischen, romanischen und
jüngeren Relikten (Abb. 2), der vorindustriellen Transport- und
Hebetechnik (Titelbild), alltäglicher (Abb. 3) oder spezieller Werkzeuge der Steinmetzen sowie Demonstrationen schrittweiser
Bearbeitungsformen beim Fachbesucher
einen geradezu atemberaubenden Eindruck hinterlässt.

Abb. 2: Romanisches Wasserleitungsstück

Abb. 3: Werkzeuge
Eine umfangreiche Sammlung von Messwerkzeugen aus der Steinmetzpraxis (Abb. 4), die Rekonstruktion einer einfachen Gattersäge
(die „Mannersdorfer Steinsäge“) sowie eine Mustersammlung wichtiger Leithakalksteine mit einer Übersichtskarte ihrer Herkunft und
ausgewählter bekannter Dekorationsgesteine aus Österreich (Abb. 5; u.a. Adnet und Untersberg) bieten sowohl für den an Bearbeitungstechniken
als auch den gesteinskundlich orientierten Besuchern eine vielseitige und anschauliche Informationsquelle. Die Auswahl der gezeigten
Objekte ist rundum gelungen und es blieb dabei wohl kaum ein Aspekt unbeachtet.

Abb. 4: Messwerkzeuge der Steinmetzen

Abb. 5: Mustertafeln wichtiger Werksteinsorten
Wie kam es zu dieser einzigartigen und vielleicht umfangreichsten Ausstellung ihrer Art in Europa? Der
Steinmetzmeister Friedrich Opferkuh aus Mannersdorf am Leithagebirge sah es im Verlaufe seines Arbeitslebens als seine
Passion an, auf jegliche historische Zeugnisse des Steinabbaus und der Verarbeitung in der Region zu achten.
Sein Blick verleitete ihn schliesslich zum Aufbau einer privaten Sammlung mit Zeugnissen der Steinverarbeitung, die wegen seiner alltagspraktischen
Fachkompetenz hohe Bedeutung erlangte. Im Jahre 1987 wurde von ihm die steinmetztechnische Abteilung im Keller des 1979 eröffneten Museums aufgebaut,
zu deren Dokumentation ein von ihm selbst verfasster Katalog gedruckt wurde. Für seine Verdienste erhielt er mehrere öffentlich verliehene Auszeichnungen und
1978 ernannte die damalige Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung Dr. Hertha Firnberg ihn zum ehrenamtlichen Korrespondenten des österreichischen
Bundesdenkmalamtes. Auf der Grundlage einer testamentarischen Verfügung ging seine inzwischen enorm angewachsene Kollektion in den Bestand des Stadtmuseums
von Mannersdorf über (Informationstafel in der Ausstellung).
Das Museumsgebäude, der „Schüttkasten“, gehört zum denkmalgeschützten Architekturerbe in Mannersdorf. Die Außenfassade ist nur spärlich mit kleinen Fensteröffnungen
versehen, da es sich um einen herrschaftlichen Speicher handelt. Alle historischen Fenstergewände wurden als Massivarbeiten aus dem hiesigen Kalkstein gefertigt.
In seinem Eingangsbereich betritt man die Räumlichkeiten über zwei Stiegenstufen aus Leithakalkstein, vor und nach denen sich der Fußboden aus handbekanteten
quadratischen Platten des Solnhofener Plattenkalks fortsetzt (Abb. 6).

Abb. 6: Museum Eingang, Leithakalkstufen und Solnhofener Platten
An der straßenseitigen Fassade des Stadtmuseums sind die Kopien von zwei römischen Grabsteinen aufgestellt. Der eine stammt aus Au im Leithagebirge
(Original heute in Carnuntum) und der andere wurde in Margarethen am Moos (Original dort in der Pfarrkirche) aufgefunden.
Zur musealen Aufarbeitung des Kalksteinabbaus im hiesigen Abschnitt des Leithagebirges gehört ein Lehrpfad am Westhang dieses hier zu
Niederösterreich gehörenden Höhenzuges. Hier sind mehrere große Objekte aufgestellt, die den Steintransport und die Handwerkskunst der
Steinmetze veranschaulichen. Auf diesem Wege gelangt man am südlichen Ortsrand zum Steinbruch Baxa (Abb. 7) und einem restaurierten
Kalkofen (Rumford-Prinzip, bis 1960 betrieben; TSCHANK, 2013: Faltblatt), der im Erdgeschoß als Kunstgalerie eines Vereins genutzt wird und im
Obergeschoss eine reichhaltige museale Ausstellung über die Branntkalkgewinnung an diesem Ort beherbergt (Abb. 8). Diese historische Dokumentation zur
Nutzung des Kalksteins ergänzt die im Stadtmuseum dargestellten steinmetzmäßigen Verwendungen.

Abb. 7: Kalkofen am Baxa-Steinbruch

Abb. 8: Kalkofen-Museum
Was sind Leithakalksteine?
Leithakalksteine (kurz Leithakalke) sind als Werksteine seit mehreren Jahrhunderten vielseitig verwendet worden. Diese Gruppenbezeichnung
leitet sich von dem kleinen Gebirgszug des Leithagebirges westlich des Neusiedler Sees ab, das sich auf den Territorien der heutigen österreichischen
Bundesländer Burgenland und Niederösterreich erstreckt.
Wegen ähnlicher petrologischer Merkmale und gemeinsamer geologischer Entstehungsgeschichte der Werksteinvorkommen werden auch die Steinbrüche
im «Rákos-Ruszter-Hügelzug» (ROTH VON TELEGD, 1905: 6, 30-32) bzw. «Ruster-Kroisbacher Höhenzug»
(HÄUSLER, 2010: 122) zu den Leithakalksteinen gezählt.
Dieser im Norden bei Oggau beginnende Höhenrücken erstreckt sich mit seinem südlichen Abschnitt bei Fertőrákos (Kroisbach) weiter auf ungarischem
Territorium, wo er schliesslich in das Bergland von Sopron (Ödenburg) übergeht. Ebenso zu den „Leithakalken“ werden konglomeratische Vorkommen am Rande
des Wiener Beckens zwischen Wien-Nußdorf, Atzgersdorf/Mödling und Wiener Neustadt gezählt, da sie unter ähnlichen Entstehungsbedingungen im flachmarinen
Milieu eines Meeres im Eozän (Tertiär) gebildet wurden (SCHMID, 1894: 241–243; KIESLINGER, 1951: 100; KIESLINGER,
1972: 61).
Die frühen geologischen Aufnahmearbeiten am Ostabhang des Leithagebirges und westlich um den Wallfahrtsort Loretto sowie
im «Rákos-Ruszter-Hügelzug» erfolgten durch Geologen der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt, weil das Gebiet bis 1921 zum
benachbarten Westungarn gehörte (Abb. 9).
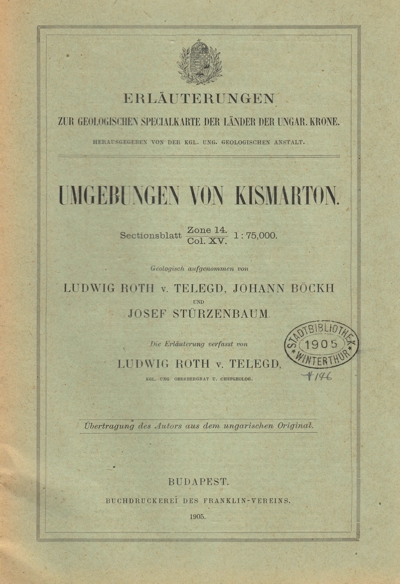
Abb. 9: ROTH VON TELEGD, 1905 –
Erläuterungen zur geol. Specialkarte der Länder der ungar. Krone, Umgebungen von Kismarton
Ein kleinerer Abschnitt des Leithagebirges wurde vor 1921 von Mitarbeitern der k.k.
geologischen Reichsanstalt in Wien geowissenschaftlich untersucht. Ungeachtet dieser damaligen Grenzlage haben die zeitweilig
beträchtlich leistungsfähigen Steinbruchunternehmen ihre Steinmetzarbeiten nach Wien und Budapest sowie für andere österreichische
und westungarische Städte geliefert (SCHAFARZIK, 1909: 383, 384). Belegstücke dieser historisch bedeutsamen Werksteine
befinden sich in der Baugesteinssammlung des Naturhistorischen Museums von Wien (KARRER, 1892: 48–50, 217) und der
Sammlung der damaligen kgl. ungarischen Geologischen Anstalt in Budapest (LÓCZY, 1910: 236). Mit dem Ausbau des
Eisenbahnwesens in der Donaumonarchie entwickelte sich ein wachsender Konkurrenzdruck durch Karstkalke aus Vorkommen in der
Umgebung von Triest und von Istrien, der durch einen Vortrag des Architekten Theophilos Hansen anlässlich der Baufortschrittes
am Parlamentsgebäude im Jahre 1878 weiter verstärkt wurde (KIESLINGER, 1972: 68).
Gesteine aus der Leitharegion fanden bereits in römischer Zeit (Steinbruch von St. Margarethen, Abb. 10) intensive Verwendung und sind durch
erhaltene Objekte historisch belegt. Geeignete Sorten, dichte und feste Leithakalksteine, waren für Gebäudesockel und Stiegenstufen gefragte
Materialien. Große Bauvorhaben in Wien, wie beispielsweise für das Kunsthistorische und Naturhistorische Museum, griffen auf solche
Werksteinvorkommen zurück (SEEMANN & SUMMESBERGER, 1998: 18–19). Am Dom St. Stephan in Wien sind verschiedene Leithakalksteine verbaut worden.
Dafür kamen Werksteine u.a. aus Mannersdorf und Au am Leithagebirge (KIESLINGER, 1949: 50) zur Verwendung. Für Ausbesserungen und Sanierungsarbeiten
wurden seit dem 19. Jahrhundert der Margarethener Stein (St. Margarethen) und der Stein von Oslip (am Silberberg) verwendet. Lieferungen aus dem
Steinbruch in St. Margareten gingen auch zur Kreuzritterkirche in Ödenburg (Sopron), zur Domkirche in Pressburg (Bratislava) und zur romanischen
Kirche in Lébény bei Györ (KIESLINGER, 1949, 52–53). Die Baulichkeiten des Franziskanerklosters in Frauenkirchen (Burgenland, Abb. 11) oder des
Schlosses Fertőd (Ungarn, Abb. 12) kamen nicht ohne Leithakalksteine aus. Ihre Verwendungsweisen sind sowohl geographisch als auch objektbezogen
ausgesprochen vielseitig. Daher sei hier auf die genannten Beispiele lediglich exemplarisch verwiesen.
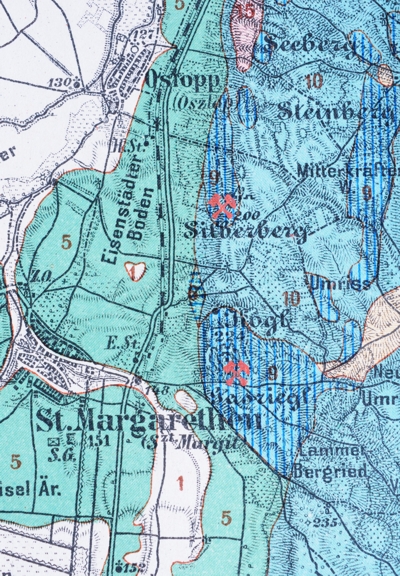
Abb. 10: Ausschnitt der geol. Karte, Steinbruch bei St. Margarethen am Kogl

Abb. 11: Frauenkirchen, Refektorium, vor der Tür Jura-Marmor-Platten, Portal aus Leithakalk, innen Solnhofener-Platten

Abb. 12: Schloss Fertöd, barocke Prachttreppe
Es gibt einerseits dichte und sehr feste Leithakalksteine (Mannersdorf, Kaisersteinbruch, Oslip, Sommerein und Wöllersdorf) und andererseits
deutlich poröse Leithakalksteine, die im bergfrischen-feuchten Zustand durch Schrämen gewonnen und mit Sägen roh bearbeitet werden können,
jedoch an der Luft beim Austrocknen an Festigkeit zunehmen (Fertőrákos/Kroisbach Abb. 13, Großhöflein, Müllendorf und St. Margarethen/Szentmargit Abb. 14).
Eine dritte Gruppe tritt durch konglomeratische Anteile in Erscheinung (Baden, Brunn und Fischau). Innerhalb eines Steinbruchs können die
gesteinsphysikalischen Eigenschaften des Werksteins stark schwanken und führen in manchen Fällen zu jeweiligen Sortenbezeichnungen durch die Steinbrecher.
Die Leithakalksteine sind das Ergebnis küstennaher Meeresablagerungen im Miozän in den chronostratigraphischen Stufen Badenium
und Sarmatium, zusammengenommen im Zeitraum vor etwa 16 bis 11 Mio. Jahren (HÄUSLER, 2020: 121–122).
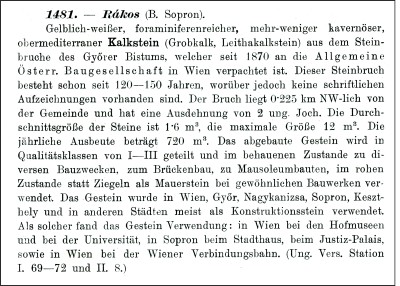
Abb. 13 Schafarzik, 1909 - Steinbruch Rákos (Kroisbach)
Bild vergrößern
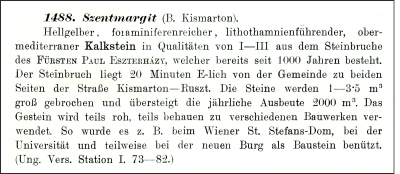
Abb. 14 Schafarzik, 1909 - Steinbruch St. Margarethen, Szentmargit
Bild vergrößern
Überwiegend bestehen die Leithakalksteine aus Skelettfragmenten von Rotalgen und ihren Kalkausscheidungen im Verlaufe des Lebenszyklus (KRENMAYR, 2002: 14).
In manchen Steinbrüchen treten terrigene Klastika auf, die sich als härtere Komponenten bemerkbar machen. Das ist beispielsweise in den Steinbrüchen bei
Sommerein der Fall, wo beträchtliche Anteile von Quarz-, Kalk- und Dolomitgeröllen sowie Bruchstücke der Gneise und Phyllite des Grundgebirges
auftreten (HÄUSLER, 2020: 124). Anders verhält es sich mit dem Kalkstein aus St. Margarethen. In diesem stark porösen Werkstein können im Anschnitt
runde Kolonien von Rotalgen (Rhodolithe) sichtbar werden. Zudem enthält er fossile Anteile von Bivalven, Kalkalgen, Echinodermen und weitere biogene
Fragmente. Der gesamte biogene Schuttanteil ist in einem calcitischen Zement eingebettet (sparitischer Kalkstein) (HÄUSLER, 2020: 126). Bei Breitenbrunn
gewann man stellenweise einen Leithakalkstein von so hoher Dichte, dass eine Politur möglich war (HÄUSLER, 2020: 125). Diese bemerkenswerte technische
Eigenschaft weisen auch vereinzelte andere Vorkommen auf, so aus dem früheren Steinbruch des Mathias Gubier in Mannersdorf oder der Steinbruch des
Steinmetzmeisters Robert Kruckenfellner in Sommerein (HANISCH & SCHMID, 1901: 172, 174).
Dank
Dieser Beitrag entstand mit Unterstützung von Museumskurator Heribert Schutzbier (Mannersdorf) und Gästeführer
Burkhard Windhager (Hof am Leithaberge). Johann Ackerl vom Stadtmuseum sorgte für die abschließende Durchsicht. Ihnen sei dafür herzlich gedankt.
Stadtmuseum von Mannersdorf am Leithagebirge und Kalkofen Baxa
Lage:
Museum
Das Museum befindet sich in innerstädtischer Lage
Jägerzeile 14-16
2452 Mannersdorf am Leithagebirge
Österreich
GPS: 47.97318,16.60553
Kalkofen Baxa
Am Goldberg | Mannersdorf
GPS: 47.96366, 16.59515
Entstehungszeit:
Stadtmuseum 1979 im „Schüttkasten“ eröffnet; die Ausstellung der Steinmetztechnik 1987 eröffnet
Weblinks:
Stadtgemeinde:
https://www.mannersdorf-leithagebirge.gv.at
Zur externen Webseite
Stadtmuseum:
https://www.stadtmuseummannersdorf.at
Zur externen Webseite
GBA (Geologische Bundesanstalt):
https://www.geologie.ac.at/rocky-austria/bausteine/molasse = Webseite „Zermahlene Alpen. Junge Sedimente im Vorland und innerhalb der Alpen“. (GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie)
Zur externen Webseite
Literatur:
HÄUSLER, H. et al. (2010): Geologische Karte der Republik Österreich 1:50 000, Erläuterungen zur Geologischen Karte 78 Rust, Wien (Geologische Bundesanstalt).
HANISCH, A. & SCHMID, H. (1901): Österreichs Steinbrüche. Verzeichnis der Steinbrüche, welche Quader, Stufen, Pflastersteine, Schleif- und Mühlsteine oder Dachplatten liefern. Wien (Verlag von Carl Graser & Co.).
KARRER, F. (1892): Führer durch die Baumaterial-Sammlung des k.k. Naturhistorischen Hofmuseums. Wien (R. Lechner's k.u.k. Hof- und Univ.-Buchhandlung).
KIESLINGER, A. (1949): Die Steine von St. Stephan. Wien (Verlag Herold).
KIESLINGER, A. (1951): Gesteinskunde für Hochbau und Plastik. Fachkunde für Steinmetzen, Bildhauer, Architekten und Baumeister. Wien (Österreichischer Gewerbeverlag).
KIESLINGER, A. (1972): Die Steine der Wiener Ringstrasse. Wiesbaden (Franz Steiner Verlag).
KRENMAYR, H.G. (2002): Rocky Austria. Eine bunte Erdgeschichte von Österreich. Wien (Geologische Bundesanstalt).
LÓCZY, L. von (1910): Führer durch das Museum der kön. Ungar. Geologischen Reichsanstalt. Budapest.
OPFERKUH, F. (o. J.): Steinmetztechnik im Museum Mannersdorf a. Lgb. (Kultur- und Museumsverein Mannersdorf a. Lgb. und Umgebung).
ROTH VON TELEGD, L. (1905): Erläuterungen zur Geologischen Specialkarte der Länder der Ungarischen Krone. Umgebungen von Kismarton. Sectionsblatt Zone 14, Col. XV., 1:75.000, herausgegeben von der kgl. ungarischen geologischen Anstalt, Budapest (Franklin-Verein).
ROTH VON TELEGD, L., BÖCKH, J., STÜRZENBAUM, J. & GABROVITZ, C. (1903): Kismarton Vidéke 1:75.000, 14. Zona, XV. Rovat. Budapest (kgl. ungarische geologische Anstalt)
SCHAFARZIK, F. (1909): Detaillierte Mitteilungen über die auf dem Gebiete des ungarischen Reiches befindlichen Steinbrüche (Publikationen der königlichen ungarischen Geologischen Reichsanstalt), Budapest (Franklin-Verein).
SCHMID, H. (1894): Die Kalksteinbrüche der Randgebirge des Wiener Beckens, insbesondere des Leithagebirges. In: Der österr. ungar. Bildhauer und Steinmetz. Officielles Organ der Wiener Bildhauer-Genossenschaft. 2. Jg. Nr. 15 (Mai 1894): 241–243.
SEEMANN, R. & SUMMESBERGER, H. (1998): Wiener Steinwanderwege. Die Geologie der Großstadt. Wien, München (Verlag Christian Brandstätter).
TSCHANK, K. (2013): Von Steinmetzen, Steinbrechern und Kalkbrennern am Leithaberg. „Baxa“ Kalkofen- und Steinabbaumuseum, Mannersdorf im Leithagebirge (Faltblatt zum Kalkofen).
Lagekarte
Tippen Sie auf die Symbole, dann erhalten Sie die Bezeichung der Lokalität.